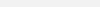ONLINE-FORUM
Stirbt das Wirtshaus, so stirbt auch das Dorf?!
live am 18. Juli 2023 I 10.00 bis 11.30 Uhr
ONLINE-FORUM
live am 18. Juli 2023 I 10.00 bis 11.30 Uhr
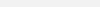

Lehrstuhl Kulturgegraphie
Universität Bamberg


Erste Bürgermeisterin
Markt Kinding

Inhaber und Geschäftsführer
Gaststätte Röhrl

Mitinitiator
Genossenschaftswirtshaus
“Ein Dorf wird Wirt!”

Erster Bürgermeister
Gemeinde Biessenhofen
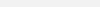
Alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist: Um die traditionellen Wirtshäuser in Bayern vor dem Aussterben zu bewahren, muss viel getan werden – darüber waren sich alle Expert*innen einig, die im Rahmen des dritten Jahresdialogs diskutierten. Gesprächsteilnehmer*innen aus Wissenschaft, Politik und der Gastronomie berichteten aus der Praxis, erläuterten Herausforderungen und zeigten Lösungswege auf. Prof. Dr. Marco A. Gardini (stellvertretender Leiter des Bayerischen Zentrum für Tourismus) führte als Moderator durch die 90-minütige Veranstaltung.
In einem Impulsvortrag ging Prof. Dr. Marc Redepenning, auf die Merkmale und Funktionen der klassischen bayerischen Wirtshäuser ein. Sie seien einerseits bedeutsam für die Versorgung und die lokale Wirtschaftskraft, andererseits erfüllten sie eine spezielle Kulturfunktion. Ihre wichtigste Aufgabe liege allerdings darin, als sozialer Treffpunkt zu dienen und Menschen zusammenzuführen. Um auch in Zukunft bestehen zu können, müsse die Treffpunktfunktion des Wirtshauses wieder gestärkt und ein Weg gefunden werden, die Menschen vor Ort mehr in die Prozesse mit einzubinden. „Nur, wenn alle an einem Strang ziehen, kann das Wirtshaus überleben.“
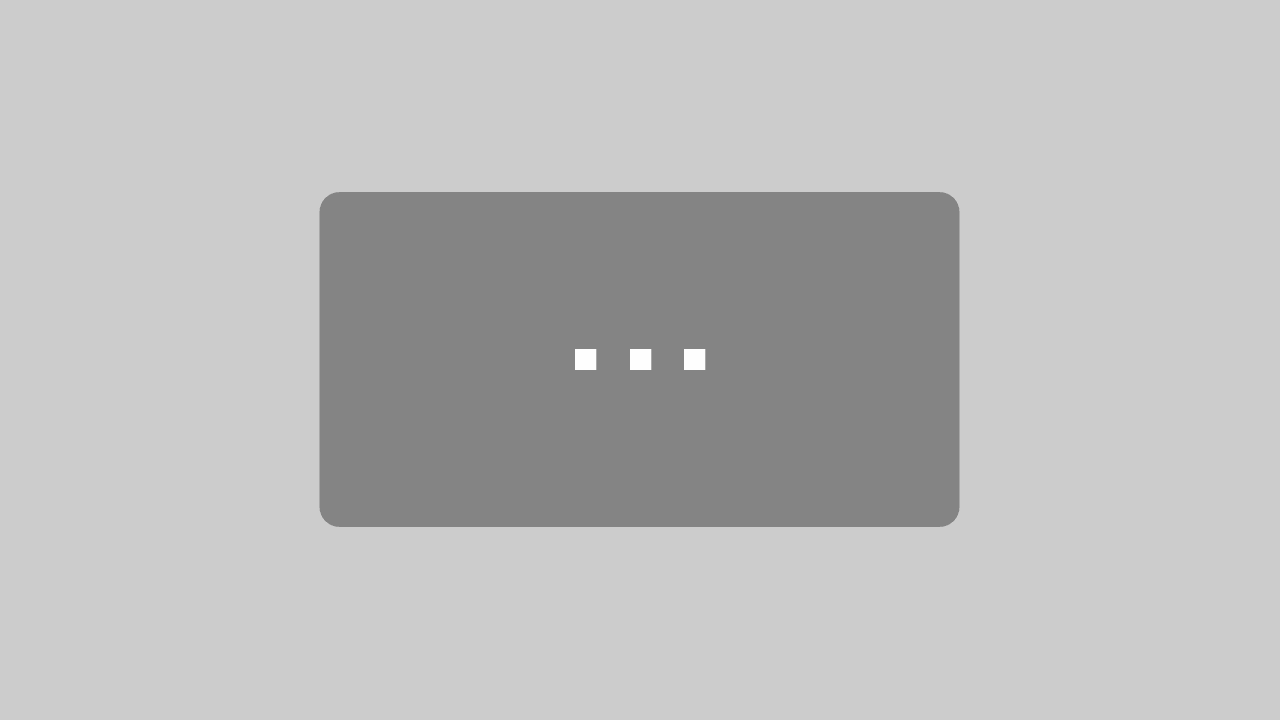
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Monika Poschenrieder sieht das Wirtshaussterben als schleichenden Prozess, dem vielfältige Gründe wie der Fachkräftemangel, steigende Kosten oder die Corona-Pandemie zugrunde lägen. Um dem entgegenzuwirken, müssten einerseits neue Konzepte geschaffen, andererseits aber auch das authentische und traditionelle Wesen der Wirtshäuser erhalten werden. „Die DEHOGA bietet den Wirten ein breitgefächertes Unterstützungsprogramm und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.“ Aktuell kämpfe der Verband unter anderem darum, dass die Mehrwertsteuer für Speisen nicht wieder auf 19 Prozent angehoben werde.
Mehr Verständnis für die Wirte innerhalb der Bevölkerung forderte Rita Böhm. „Die Wirtshäuser müssen alle auch etwas verdienen und ihnen gebührt mehr Wertschätzung von Seiten der Gesellschaft“, führte sie aus. Aus ihrer Sicht sollten die Gemeinden und die Bürger mehr miteinbezogen und neue Konzepte mit einer höheren Zielgruppenorientierung umgesetzt werden.
Das sah auch Wolfgang Eurisch so. In seiner Gemeinde mussten in den letzten zehn Jahren drei von fünf Gaststätten schließen. Als Alternative dienten die Vereinsheime im Ort, die auffangen, „was wir in den Wirthäusern verloren haben.“ Etwaigen Förderprogrammen der Politik zur Verbesserung der Lage steht er skeptisch gegenüber: „Die Programme grenzen die Kreativität oftmals sehr stark ein und sorgen für viel Bürokratie.“
Dass ein traditionelles Wirtshaus auch heutzutage noch florieren kann, zeigten Muk und Karin Röhrl die als „ältestes Wirtshaus der Welt“ gilt. „Wir führen unser Wirtshaus bereits in elfter Generation“, so Karin Röhrl. Um dem allgegenwärtigen Fachkräftemangel entgegenzuwirken, setzen die Wirtsleute auf kreative Maßnahmen. „Wir haben Beschäftigte aus der ganzen Welt, von Kamerun bis Vietnam, angeworben, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können“, erklärte Muk Röhrl. “Wir setzen auf unsere fachlich fundierte Ausbildung, einen Blick für die zeitgenössischen Entwicklungen der Branche unter Berücksichtigung von Tradition und Moderne, ein gutes Marketing, eine konkrete Positionierung und Authentizität.”
Am Beispiel von Robert Soukup wurde schließlich deutlich, was daraus erwachsen kann, wenn die Bürger in einem Dorf das Schicksal ihres Wirtshauses selbst in die Hand nehmen. Als der Gaststätte in seinem Wohnort der Verfall drohte, gründete er mit anderen Einheimischen eine Genossenschaft zum Erhalt des Wirtshauses. Die Renovierungsarbeiten leisteten die Bewohner größtenteils selbst, heute läuft die Gaststätte wieder. „Das Vereinsleben findet wieder im Wirtshaus statt – glaubwürdig, regional, und authentisch.“
Im Hinblick auf das Wirtshaus der Zukunft waren sich die Teilnehmer einig: Es brauche Konzepte, die Tradition und Moderne vereinen, die alle Dorfbewohner*innen mitnehmen und auch die nächsten Generationen ansprechen. Dabei dürfe die Leidenschaft für den so außergewöhnlichen Beruf des Wirts nicht verloren gehen. Die Aufgabe, das Wirtshaus als bayerisches Kulturgut und als sozialen Dreh- und Angelpunkt vieler Dörfer und Gemeinden zu erhalten, sei eine lokale Gemeinschaftsaufgabe, an der viele Akteure, wie die Wirt*innen, die Bürger*innn, die Vereine und nicht zuletzt die Politik mit all ihrer Kreativität an zukunftsfähigen Lösungen arbeiten müssten. Denn jedes Dorf habe eine gute Gastwirtschaft verdient, so Prof. Dr. Marco A. Gardini in seinem Schlusswort.