GEFÖRDERTES PROJEKT 2023/2024
Schlagworte: Finanzierung, Tourismusabgaben
Erwartbare Auswirkungen eines abgabenfinanzierten Tourismus auf bayerische Destinationen – Eine empirische Analyse der kausalen Effekte neuer Tourismusabgaben in Deutschland
© iStock.com/FooTToo
Die anhaltend hohen Ausgabenbelastungen der Kommunen durch Pandemie, Inflation und Alterung der Gesellschaft stellen die künftige Finanzierung des Tourismus in Bayern vor große Herausforderungen. Die Ankündigung einer Bettensteuer für München löste im Spätherbst 2022 eine intensive Debatte zu möglichen Auswirkungen einer Abgabenfinanzierung des Tourismus im Freistaat aus. Vor diesem Hintergrund widmet sich das beantragte Projekt einer umfassenden Analyse der möglichen Auswirkungen neuer Tourismusabgaben in bayerischen Destinationen auf zwei Arten:
- Erstens liefert es einen umfassenden Überblick über den Kenntnisstand der theoretischen wie empirischen Literatur zur Wirkung von Tourismusabgaben in unterschiedlichen Arten von Destinationen. Dies, zumal die vorhandene Literatur starke Hinweise dafür liefert, dass die Auswirkungen maßgeblich von der Ausprägung von Alleinstellungsmerkmalen einer Destination abhängen sowie der damit verbundenen unterschiedlich stark ausgeprägten Preissensitivität der (potenziellen) Gäste.
- Zweitens nutzt es die Einführung von tourismusbezogenen Steuern und Gebühren in einer Reihe von deutschen Destinationen außerhalb Bayerns als „quasi-natürliche Experimente“, um im Rahmen umfassender empirischer Analysen erstmalig zu untersuchen, wie sich die Einführung verschiedener Abgaben in unterschiedlichen Arten von Destinationen anderer deutscher Bundesländer – wie etwa Kultur- und Städtedestinationen, verschiedene Typen von ländlichen Destinationen – und auf verschiedene Zielgrößen – wie etwa Übernachtungen, Ankünfte, Zahl der Betten und Betriebe – auswirkte.
Methodisch bedient sich die empirische Analyse modernster ökonometrischer bzw. statistischer Ansätze. Diese ermöglichen die Identifikation von kausalen Effekten neuer Abgaben (und zeigen nicht nur Korrelationen und Entwicklungen von Zielgrößen über die Zeit auf). Die gewonnen Erkenntnisse lassen unmittelbare Rückschlüsse über die erwartbaren Effekte neuer tourismusbezogener Abgaben in unterschiedlichen bayerischen Destinationen zu. Das Projekt trägt daher maßgeblich zu einer effizienten Tourismuspolitik und evidenzbasierten Debatte über die Finanzierung des bayerischen Tourismus bei. Je eine Publikation in einem internationalen akademischen Journal und einer stärker tourismuspolitisch ausgerichteten, deutschsprachigen Zeitschrift, sowie die aktive Diffusion der Ergebnisse auf Tagungen und über die Medien stellen den Transfer der Erkenntnisse in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sicher.
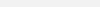
Projektverantwortung
Projektleitung: Prof. Dr. Matthias Firgo (Fakultät für Tourismus, Hochschule München)

